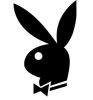Der Film-Verrückte: Wie tickt eigentlich Quentin Tarantino?

Menu

Close

Er ist ein Besessener, der ultimative Nerd. Ein Mann, der den Mainstream ebenso liebt wie den Trash. Quentin Tarantino verehrt das Kino in all seinen Facetten. Mit seinem Film „Once Upon a Time in... Hollywood“ hat er seiner Leidenschaft ein Denkmal gesetzt. Tarantino führt den Zuschauer an das Ende der 1960er-Jahre – in eine Zeit, in der die Hippies die Traumfabrik mit Kassenschlagern wie „Easy Rider“ und „Die Reifeprüfung“ übernahmen. Und in das Jahr 1969, in dem die Ära der Blumenkinder durch den bestialischen Mord an Roman Polanskis Frau Sharon Tate durch die Mitglieder der Manson Family ihre Unschuld verlor.

Vor dem Hintergrund dieser Zeit erzählt Tarantino von dem abgehalfterten TV-Star Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), der mithilfe des Stuntmans Cliff Booth (Brad Pitt) seiner Karriere neuen Schwung verleihen möchte. Dabei kreuzen sie die Wege von Hollywood-Ikonen wie Bruce Lee (Mike Moh), Steve McQueen (Damian Lewis) und Sharon Tate (Margot Robbie). Etwas mehr als fünf Jahre lang arbeitete Tarantino am Drehbuch und schrieb es wie einen Roman, zeichnete die Figuren und entschied sich dann für den Ton und die Richtung, die die Geschichte einschlagen sollte. Mit „Once Upon a Time in... Hollywood“ schließt sich für den 56-Jährigen ein Kreis.
Denn im Kern ist der Film für ihn eine Liebeserklärung an die Stadt, in der er die Leidenschaft fürs Kino entdeckte und die ihn zum Superstar unter den Regisseuren gemacht hat. Hier sah er als kleines Kind nach der Trennung seiner Eltern und dem Umzug von Knoxville/Tennessee in die Stadt der Engel seine ersten Filme; im Gedächtnis blieben aber oftmals nur Versatzstücke. Erst Jahre später konnte er sie wieder zuordnen, wenn er in Filmen zufällig auf die Szenen und Dialoge stieß, die sich ihm eingebrannt hatten. Der erste Film, an den er sich erinnern kann: die schräge James-Bond-Kopie „Heiße Katzen“ (1967). Seinen Stil als Regisseur und fürs Drehbuch haben aber andere Werke geprägt: zum Beispiel Mario Bavas „Die drei Gesichter der Furcht“ (1963), Sergio Leones „Spiel mir das Lied vom Tod“ (1968) und John G. Avildsens „Rocky“ (1976).
Mehr zum Thema: "Der Mord an Sharon Tate: Als das goldene Hollywood starb"
Als Tarantino 1985 mit 22 Jahren begann, in der von Drehbuchautoren und Filmfreaks frequentierten Videothek „Video Archives“ in Manhattan Beach bei Los Angeles zu arbeiten, verfügte er bereits über ein geradezu enzyklopädisches Filmwissen. Nun aber konnte er es noch ausbauen. Ob französische Nouvelle Vague, deutscher Expressionismus oder chinesisches Kung-Fu-Action-Kino: Auf einen Schlag hatte er Zugang zur kompletten Filmgeschichte. Heute ist er ein Teil von ihr. Tarantino dreht vorzugsweise auf 35-Millimeter-Film statt digital. Er hat eine besondere Beziehung zu diesem selten gewordenen Material.
„Ich sammle 35-Millimeter-Kopien und zeige sie in meinem eigenen Kino“, hat er einmal erzählt. „Für Steve McQueens persönliche Kopie von ‚Papillon‘, die 20 Minuten länger ist als die Kinofassung, habe ich 7000 Dollar bezahlt.“ Daneben beherbergt Tarantino eine beachtliche Filmkollektion, darunter zahllose Italo-Western – ein Genre, dessen Einflüsse sich durch all seine Filme ziehen, von „Reservoir Dogs“ (1992) bis „The Hateful Eight“ (2015). „In diesen Filmen“, sagt Tarantino, „ist die Gefahr allgegenwärtig, und der Tod lauert hinter jeder Ecke.“ Kritiker werfen ihm gern vor, die Filmgeschichte ungeniert zu kopieren.




Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Er selbst sagt: „Beim Schreiben meiner Drehbücher kommen mir immer wieder Filme in den Sinn, die ich mal gesehen habe und aus denen ich aus meiner Erinnerung zitiere. Wenn ich sie mir dann aber angucke, gibt es große Unterschiede zwischen dem Original und meinen Erinnerungen.“ Und daran besteht kein Zweifel. Ob er nun wie in „Django Unchained“ die Geschichte der Sklaverei im Stil eines Italo-Westerns erzählt oder in „Kill Bill – Volume 1“ Lucy Liu als Inkarnation von Lady Snowblood (der Heldin des gleichnamigen japanischen Action-Films von 1973) zur Disco-Version von „Don’t Let Me Be Misunderstood“ das Schwert ziehen lässt: Es ist gerade Tarantinos Mut zu Stilbrüchen, der ihn zu Hollywoods größtem Autorenfilmer werden ließ. Und ihm zwei Oscars beschert hat.
Bei der Darstellung von Gewalt geht Tarantino, der 2018 die israelische Sängerin Daniella Pick geheiratet hat, selten Kompromisse ein: Blutfontänen und Splattereinlagen gehören für ihn zum guten Ton. Doch martialische Exzesse sind in seinen Filmen nie Selbstzweck, sondern Stilmittel: Tarantino überhöht die Gewalt und lässt sie am Ende ins Groteske abgleiten. Humor ist bei ihm essenziell, auch wenn diesen nicht alle Zuschauer auf Anhieb erfassen. Besonderen Anteil an Tarantinos Erfolg haben seine oftmals so derben – allein in „Reservoir Dogs“ finden sich 272 „Fucks“ – wie temporeichen und in ihrer vordergründigen Trivialität komplexen Dialoge.
Ob Christoph Waltz 2010 ohne seinen minutenlangen Monolog zu Beginn von „Inglourious Basterds“ mit einem Oscar ausgezeichnet worden wäre? In Zeiten von Comic-Verfilmungen und Materialschlachten, in denen das gesprochene Wort den Effekten untergeordnet wird, sind Tarantinos Dialoge ein Segen. Wer kann sich fünf Minuten nach dem Abspann noch an einzelne Sätze aus „Avengers: Endgame“ erinnern? Mit Sätzen wie „Oh Mann, ich hab Marvin ins Gesicht geschossen!“ (aus „Pulp Fiction“) aber bekommt man auch heute noch manche Party auf Betriebstemperatur. Tarantino ist ein Meister der Sprache. Und ein Method Director. Ein Regisseur, der beim Schreiben seiner Drehbücher eins mit den Figuren wird.
„Bei ‚Kill Bill‘ war ich ein Jahr lang die Braut“, sagt er. Was die Wahl seiner Helden betrifft, macht er keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und verlangt ihnen am Set das Gleiche ab. Bei Uma Thurman allerdings ging er dann doch etwas zu weit: Ein Auto-Stunt in „Kill Bill – Volume 1“, zu dem er sie gedrängt hatte, geriet außer Kontrolle: Der Wagen fuhr mit rund 60 km/h gegen einen Baum. Thurman trug laut „Hollywood Reporter“ eine Gehirnerschütterung sowie Verletzungen an den Knien davon. Tarantino entschuldigte sich und übernahm die Verantwortung, wie Thurman auf Instagram verriet.
Zögerlicher dagegen gab er sich im Fall Harvey Weinstein: Der mächtige Miramax-Boss protegierte Tarantino seit „Pulp Fiction“ und war maßgeblich an dessen Aufstieg beteiligt. Als die Anschuldigungen gegen Weinstein wegen sexueller Übergriffe 2017 öffentlich wurden, schwieg Tarantino wochenlang. Am Ende entschuldigte er sich in der „New York Times“ dafür, dass er nicht schon früher etwas gesagt und Verantwortung übernommen hatte. „Once Upon a Time in... Hollywood“ ist Tarantinos neunter Film. Nach dem zehnten, so hat er angekündigt, möchte er zurücktreten. „Ich habe das Gefühl, dass ich das getan habe, was ich machen wollte und sollte.“
Werden seine Werke auch nach seinem Ruhestand noch gefeiert werden? Mit Sicherheit. Denn Tarantino erzählt nicht bloß Geschichten, er erschafft Happenings, die Menschen beschäftigen. Lässige, provokante und trotz ihrer altmodischen Machart zeitlose Filmereignisse. Selbst für eine Generation, die noch nie von Sergio Leone gehört hat.