„Es outen sich nicht ansatzweise so viele homosexuelle Spieler, wie es gibt“

Menu


Xenia Prinzessin von Sachsen lässt bitten: Zu einem erotischen Stelldichein auf Teneriffa. Ein königliches Bade- und Bilder-Vergnügen …
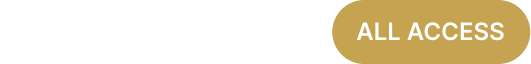
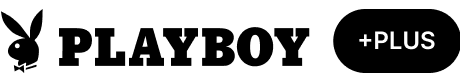
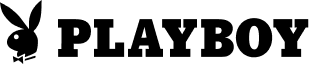
 E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben
E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben 250.000+ exklusive Fotos und Videos
250.000+ exklusive Fotos und Videos Internationale Coverstars und Playmates
Internationale Coverstars und Playmates 70 Jahre Playboy-Geschichte
70 Jahre Playboy-Geschichte 250.000+ exklusive Fotos und Videos
250.000+ exklusive Fotos und Videos Internationale Coverstars und Playmates
Internationale Coverstars und Playmates 70 Jahre Playboy-Geschichte
70 Jahre Playboy-Geschichte inkl. E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben
inkl. E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche
Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben
Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper
Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper Alle Stories auf Playboy.de
Alle Stories auf Playboy.de Alle Stories auf Playboy.de
Alle Stories auf Playboy.de Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper
Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben
Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche
Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche Die Galerie des Tages
Die Galerie des Tages Abstimmung für die Galerie von morgen
Abstimmung für die Galerie von morgenJährlich
20 % SPAREN
1,99 € pro Woche
3,99 € pro Woche
4-wöchentlich
2,49 € pro Woche
4,99 € pro Woche
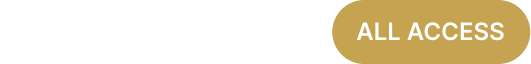
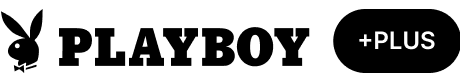
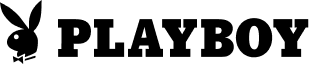
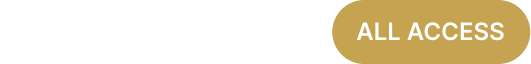
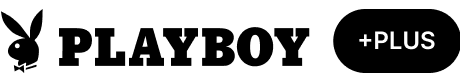
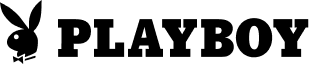
 E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben
E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben 250.000+ exklusive Fotos und Videos
250.000+ exklusive Fotos und Videos Internationale Coverstars und Playmates
Internationale Coverstars und Playmates 70 Jahre Playboy-Geschichte
70 Jahre Playboy-Geschichte 250.000+ exklusive Fotos und Videos
250.000+ exklusive Fotos und Videos Internationale Coverstars und Playmates
Internationale Coverstars und Playmates 70 Jahre Playboy-Geschichte
70 Jahre Playboy-Geschichte inkl. E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben
inkl. E-Paper-Archiv mit 250+ Ausgaben Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche
Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben
Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper
Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper Alle Stories auf Playboy.de
Alle Stories auf Playboy.de Alle Stories auf Playboy.de
Alle Stories auf Playboy.de Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper
Die letzten 3 Ausgaben als E-Paper Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben
Alle Fotos und Videos der Coverstars und Playmates der letzten 3 Ausgaben Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche
Die vollständigen Galerien des Tages inkl. Archiv der aktuellen Woche Die Galerie des Tages
Die Galerie des Tages Abstimmung für die Galerie von morgen
Abstimmung für die Galerie von morgenJährlich
20 % SPAREN
1,99 € pro Woche
3,99 € pro Woche
4-wöchentlich
2,49 € pro Woche
4,99 € pro Woche
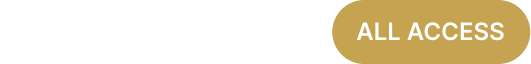
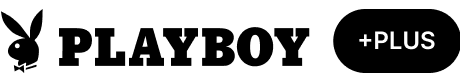
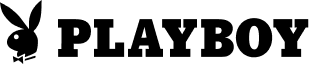
Thomas Hitzlsperger schaltet sich von London aus zum Video-Interview zu. Im vergangenen Jahr hat er dort das älteste französische Restaurant der Stadt übernommen, das „L’Escargot“ in Soho. Nachdem er Nationalspieler, TV-Experte und Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart war, ist er nun also auch Gastronom. Und hat als solcher gerade viel zu tun. Für unser Gespräch aber nimmt er sich Zeit. Der Anlass: die Dokumentation „Das letzte Tabu“ (ab 13. Februar auf Prime Video) über Homosexualität im Profi-Fußball. Auch Hitzlsperger erzählt in dem so erhellenden wie bewegenden Film seine Geschichte. Als erster deutscher Fußball-Star sprach er im Januar 2014, wenige Monate nach Ende seiner aktiven Karriere, offen über seine Homosexualität. Am Morgen unseres Interviews postet er auf X: „Heute vor zehn Jahren zwang ich den zeitonline-Server in die Knie. Es war trotzdem ein guter Tag.“ Ganz klar: ein besonderes Datum, an dem unser Gespräch stattfindet.
Herr Hitzlsperger, auf den Tag genau vor einem Jahrzehnt erschien in der „Zeit“ das Interview, in dem Sie erstmals öffentlich über Ihre Homosexualität sprachen. Haben Sie Ihr öffentliches Coming-out je bereut?
Zu keinem Zeitpunkt. Wobei es mir damals nicht in erster Linie darum ging, der Welt mitzuteilen, dass ich homosexuell bin.
Sondern?
Ich wollte vor allem die Diskussion über Homosexualität im Profi-Sport und in der Gesellschaft voranbringen. Prominente Fußballer wurden damals immer mal wieder gefragt: Sollen sich schwule Fußballer outen? Und wenn ich die Antworten hörte, dachte ich häufig, ich könnte aufgrund meiner Erfahrungen einen wertvolleren Beitrag zur Diskussion beisteuern.
Thomas Hitzlsperger im Playboy-Interview: „Es ist mir zu kurz gegriffen, wenn man sagt, nur der Fußball hat ein Problem mit Homosexualität“
Sie hatten damals für den dritten Tag nach Erscheinen des Interviews einen Flug nach Hawaii gebucht. Aus Angst vor den Reaktionen?
Nein, aber ich wusste, dass es ein großer Augenblick werden könnte. Ich sagte mir, ich gebe mir ein paar Tage Zeit, um mögliche Interviewanfragen zu beantworten, und dann muss Schluss sein, weil erst mal alles gesagt wurde. Ich wollte nicht von Talkshow zu Talkshow tingeln und mich dabei ständig wiederholen.
Was ist Ihr Eindruck: Wie hat sich die Lage für homosexuelle Profis zehn Jahre nach Ihrem Coming-out verändert?
Aus persönlicher Sicht kann ich sehr viel Positives berichten. Die Sorgen und Ängste, die ich vor dem Coming-out hatte, haben sich kaum bewahrheitet. Mein Leben ist gut verlaufen, ich habe sehr viel Zuspruch bekommen und kaum Diskriminierung erfahren. Ich habe Jobs bekommen in allen Bereichen, habe fürs Fernsehen gearbeitet, für Fußballclubs. Persönlich ziehe ich also eine sehr positive Bilanz. Andererseits bekomme ich natürlich mit, dass es nach wie vor Anfeindungen und Ausgrenzung gibt. Und dass die Fälle von Hasskriminalität nicht weniger werden, sondern eher zunehmen. Zudem wissen wir ja alle, wie sich die politische Situation in Deutschland und anderen Ländern verändert. Daher sehe ich es nach wie vor als wichtig an, dass ich und andere sich zu Wort melden und sagen: Wir räumen mit Vorurteilen auf und akzeptieren die Diskriminierung und Ausgrenzung nicht.
Wie hat sich die Situation im Fußball selbst verändert?
Positiv ist: Regenbogensymbole sind heute bei Fußball-Events keine Seltenheit mehr. Die Bekenntnisse von Clubs und Verbänden zur Vielfalt und gegen Diskriminierung haben zugenommen. Und ich kann sagen: Ich fühle mich wohl im Fußballgeschäft, fühle mich nicht ausgegrenzt, das ist für mich immer der Gradmesser. Nur klar ist auch: Wir sehen nicht deutlich mehr Spieler, die sich öffentlich geoutet haben. Es gibt mittlerweile einige …
… wie zum Beispiel Jake Daniels, der in der zweiten englischen Liga spielte, als er 2022 offen über seine Homosexualität sprach, oder der tschechische Profi Jakub Jankto, der das im Februar 2023 als Spieler von Sparta Prag tat.
Genau, es gibt also eine gewisse Entwicklung. Aber es outen sich nicht ansatzweise so viele homosexuelle Spieler, wie es gibt. Und das ist eine Enttäuschung, wenn man bedenkt, dass sich die Rahmenbedingungen alles in allem verbessert haben.
Bis heute hat kein aktiver Profi-Spieler in Deutschland seine Homosexualität öffentlich gemacht. Woran, glauben Sie, liegt das?
Es ist die Entscheidung eines jeden einzelnen Menschen. Ich nehme an, es hat sich persönlich einfach niemand bereit dafür gefühlt, weil mit einem Coming-out Veränderung verbunden ist. Diese Ungewissheit schreckt womöglich viele ab. Ich würde es nicht auf „den Fußball“, „die Medien“ oder „die Fans“ schieben. Das wäre zu kurz gegriffen. Sie waren nicht der erste deutsche Fußballer, der sich geoutet hat. Bereits 2007 tat das Marcus Urban. Er war als junger Spieler auf dem Weg zum Profi, beschloss aber, seine Laufbahn zu beenden, weil der psychische Druck, den er als homosexueller Fußballspieler spürte, schwer auf ihm lastete. In „Das letzte Tabu“ erzählt Urban davon, dass er sich als Jugendlicher seine erotischen Fantasien mit Männern „sofort verboten“ und das Thema verdrängt habe.
Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an die Phase in Ihrem Leben zurückdenken, in der Sie sich Ihrer eigenen Homosexualität bewusst wurden?
Bei mir kam gegen Ende meiner Karriere der Punkt, an dem ich es mir eingestanden habe. Meine Zeit bei Lazio Rom Anfang 2010 war schwierig, und da wurde mir immer bewusster, dass meine Probleme auf dem Platz nicht nur sportliche Gründe hatten. Als ich in der Folge dann merkte, okay, das ist halt so, ich brauche davor nicht mehr wegzulaufen, dann ging es darum, wie kann ich offensiv mit der Thematik umgehen. Was ging in Ihrem Kopf vor? Ich habe mir überlegt: Muss ich darüber öffentlich sprechen? Was bedeutet das für mich? Verändert das meinen Fußball? Spiele ich danach besser? Schlechter? Beruhigend war für mich die Tatsache, dass ich ja schon viele Jahre gespielt hatte und das auch erfolgreich. Mir war bald bewusst: Ich habe nach meinem Karriereende noch viele Lebensjahre vor mir, und ich möchte mich nicht ein Leben lang verstecken und das geheim halten. Das möchte und werde ich nicht aushalten. Und dann ging der Blick nur noch nach vorne: Wie gehe ich am besten damit um? Was kann ich jetzt noch bewirken für mich und andere?
Sie sagen in der Doku, dass Sie damals schon die Geschichte von Justin Fashanu kannten. Fashanu war 1990 in England der erste Fußball-Profi, der als noch aktiver Spieler öffentlich sein Coming-out hatte. Acht Jahre später beging er Suizid. Er hinterließ einen Brief, in dem stand: „Schwul und eine Person des öffentlichen Lebens zu sein ist hart.“ Hat diese Geschichte Sie beeinflusst im Umgang mit Ihrer eigenen Situation?
Nicht in dem Sinne, dass ich Sorge hatte, mein Leben könnte ähnlich verlaufen. Im Vergleich zur Zeit von Fashanus Coming-out waren wir ja schon weiter. Ich hatte auch mit der Familie und Freunden gesprochen und wusste: Ich habe Unterstützung. Fashanu war eher auf sich allein gestellt. Aber ich habe mir natürlich sehr viele Gedanken gemacht. Ich ging ins Training und dachte mir schon das ein oder andere Mal: Wie kommt das an, wenn ich mich oute? Wie reagiert dieser? Was macht jener? Was verändert sich dadurch? Ich spürte auch eine große Verantwortung für die Mannschaft und ihren Erfolg. Das hat mich abgeschreckt. Ich wollte nicht mein persönliches Anliegen über den Erfolg der Mannschaft stellen. Meine Sorge war, der Mannschaft mit einem Coming-out etwas zuzumuten, das sie nicht gebrauchen kann. Dazu kam, dass ich in den Teams gegen Ende meiner Karriere kein Leistungsträger mehr war.
Wie wurde in ihrer aktiven Zeit über das Thema Homosexualität in der Kabine gesprochen?
Das Thema war nicht oft präsent. In einer Fußballmannschaft wird primär über Fußball geredet, das nächste Training, das nächste Spiel. Dass über Homosexualität oder Homophobie gesprochen wurde, kam nur punktuell vor. Zum Beispiel, wenn ein Spieler dazu etwas in der Zeitung gelesen hatte und meinte: Habt ihr gesehen? Der hat dies und das gesagt. Dann wurde halt kurz drüber diskutiert.
Sie hatten also nicht das Gefühl, dass in der Kabine so abschätzig über Homosexualität gesprochen wurde, dass Sie das zusätzlich davon abhielt, offen darüber zu sprechen?
Doch, das habe ich schon erlebt. Ich erinnere mich an zwei Situationen, die mir nicht mehr aus dem Kopf gingen, weil einzelne Spieler sehr abschätzig über Homosexuelle sprachen. Und ich dachte: Okay, das ist der Beleg dafür, dass ich in dieser Kabine ein Problem habe, wenn ich das offen ausspreche.
In den vergangenen Jahren hat sich gesellschaftlich ja viel getan. In der Welt der Kunst oder auch in der Politik ist es eigentlich kein Thema mehr, ob jemand homosexuell ist. Warum ist es im Fußball noch eines, während es in allen anderen Bereichen vorangeht?
Das würde ich einschränken. Ja, in der Politik ist es sichtbarer. Aber was ist zum Beispiel mit Schauspielern? Können Sie mir spontan eine Handvoll Schauspieler aufzählen, prominente Schauspieler, die offen homosexuell sind? Was ist mit der katholischen Kirche? Ist es da wirklich völlig okay zu sagen, ich bin schwul? Und andere Sportarten – wie viele Handball- oder Basketball-Profis in Deutschland sind bekennend homosexuell? Es ist mir zu kurz gegriffen, wenn man sagt, nur der Fußball hat ein Problem mit Homosexualität. Da übersehen wir, dass das auch in vielen anderen Gesellschaftsbereichen noch immer der Fall ist.
Was denken Sie, warum ist das nach wie vor so?
Es dauert eben, bis sich das verändert. Ich denke, dass in allen Gesellschaftsbereichen nach wie vor bei zu vielen Menschen schwul in Verbindung steht mit negativ, schlecht, weich. Man sieht das zum Beispiel an der Sprache. Wenn etwas uncool ist, dann ist es oftmals „schwul“, wenn beim Fußball ein Pass schlecht ist, dann hört man auch heute noch, das sei ein schwuler Pass gewesen. Es ist wichtig, wie wir mit Wörtern hantieren. Gerade Trainer und Lehrer können junge Menschen dafür sensibilisieren. Wenn du zu jemandem sagst, hey das ist aber schwul, dann kann das verletzend sein. Man muss nicht immer jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber an der ein oder anderen Stelle Sprache bewusster zu verwenden, dafür appelliere ich.
Thomas Hitzlsperger im Playboy-Interview: „Das Team braucht bei der EM die Fans – denn was die Spielstärke angeht, sehe ich uns nicht ganz vorne dabei“
Marcus Urban hat kürzlich in einem Interview gesagt, er arbeite schon seit Langem an einem Gruppen-Coming-out mehrerer Fußballer. Wäre so eine Aktion sinnvoll?
Es wäre ein sehr bedeutender Schritt. Man kann eine Gesellschaft nicht allein dadurch verändern, dass man Leuten sagt: Ihr müsst aufhören, zu diskriminieren und auszugrenzen. Was aber sehr wirkungsvoll ist: Wenn Betroffene selbstbewusst sagen, ich erkenne hier das Problem gar nicht, ich bin so, und das ist kein Makel, sondern völlig in Ordnung so! Ein Gruppen-Coming-out könnte genau diese Botschaft transportieren. Es wäre ein großer Schritt, der für sehr viel Aufmerksamkeit sorgen würde. Und dann könnte wieder eine Entwicklung stattfinden.
Ob in Russland 2018 oder zuletzt in Katar: Der Weltfußball war zuletzt in Ländern zu Gast, in denen Homosexualität tabuisiert wird oder sogar unter Strafe steht. Wie beurteilen Sie den Umgang des Fußball-Weltverbands FIFA mit dem Thema Homophobie?
Schwieriges Thema, darüber könnten wir ein eigenes Gespräch führen. Kurz gesagt: Einerseits scheuen sie sich nicht, Regenbogensymbole zu zeigen und sich da, wo es genehm ist, für Vielfalt auszusprechen. Andererseits drücken sie dort, wo die Möglichkeiten des Geldmachens und der Profilierung gegeben sind, auch mal die Augen zu bei dem Thema. Dieses Verhalten ist schon sehr grenzwertig.
Kommenden Sommer blickt die Fußballwelt nun wieder nach Deutschland. Die EM im eigenen Land steht an. Aber die Nationalelf spielt nicht gut, und so richtige Vorfreude scheint im Land noch nicht aufzukommen. Spüren Sie welche?
Ja, ich freue mich auf die EM, weil ich die tiefe Überzeugung habe: Wenn es sportlich gut losgeht, werden wir wieder Spaß haben und feiern. Sie gehörten bei der WM 2006 in Deutschland zum Kader der Nationalelf. Auch damals schien die Mannschaft vor dem Turnier nicht besonders gut drauf zu sein. Trotzdem schaffte sie es bis ins Halbfinale. Kann das wieder gelingen? Meine Hoffnung ist, dass wir es wie 2006 schaffen, den Heimvorteil zu nutzen, und durch einen guten Auftakt im ersten Spiel gegen Schottland Begeisterung auslösen. Und dann kann die Post abgehen. Die Mannschaft braucht die Unterstützung der Fans. Denn was die Spielstärke der Mannschaft angeht, sehe ich uns gerade nicht ganz vorne dabei.
Den Namen nach haben wir doch lauter Top-Spieler von großen Clubs.
Wir sind auf einigen Positionen hervorragend besetzt. Um das Tor und Mittelfeld mache ich mir wenige Sorgen. Defensiv und im Sturmzentrum sind wir aber nicht auf Top-Niveau. Wir haben da einige gute Spieler, ja, aber sie kommen in der Konstellation bei der Nationalelf nicht auf ihr Top-Niveau. Und zwar schon so lange nicht, dass es bedenklich ist. Und das sind mir dann zu viele Positionen, auf denen wir im Vergleich zu den Spitzenteams nicht so besetzt sind, dass wir zu den Favoriten gehören.
Wie sieht also Ihre Prognose für die EM aus?
Der Optimismus überwiegt. Das Halbfinale werden wir mindestens erreichen.