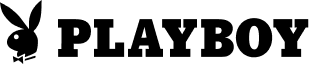Es ist neun Uhr morgens, als die Temperatur über die 30-Grad-Grenze steigt und die Luft über dem Boden langsam zu flimmern beginnt. Die Landschaft rund um Al-Ula, eine Wüstenoase in Saudi-Arabien, wirkt wie eine Filmkulisse aus „Star Wars“ oder „Mad Max“. Sand, Steine und Geröll, so weit das Auge reicht, durchzogen einer dreitägigen Quarantäne und einem negativen von gigantischen, teilweise bis zu 50 Meter hohe Felsformationen. Aus der Ferne ertönt ein Geräusch, erst ganz leise wie das Pfeifen des Windes dann wird es immer greller und lauter. Es ist das Surren eines Elektromotors. Ein paar Augenblicke später schießt ein Gelände-Buggy mit hoher Geschwindigkeit zwischen zwei Felsen hervor, gefolgt von einer riesigen Sandwolke. Am Steuer: der ehemalige World Rallycross Champion und zweifache DTM-Weltmeister Mattias Ekström vom Team Abt Cupra. Nur wenige Meter vor mir kommt er in der sandigen Boxengasse zum Still- stand. Die Regeln der Extreme E sehen vor, dass er nach der Hälfte der Strecke das Steuer an seine Teamkollegin übergeben muss. Doch dazu später mehr.
Die spannende Frage lautet jetzt erst einmal: Extreme E, was ist das eigentlich? Die Antwort: die erste vollelektrische Rallye-Rennserie der Welt. 18 Fahrerinnen und Fahrer in neun Teams treten über insgesamt fünf Rennen in den abgelegensten Teilen der Welt gegeneinander an. Doch die Extreme E will mehr sein als bloß eine Rennserie – sie will scheinbar unvereinbare Themen wie Motorsport, Umweltschutz und Gleichstellung von Mann und Frau miteinander verbinden. Inwiefern das funktioniert, will ich in den nächsten Tagen herausfinden.

Meine Mission beginnt bereits fünf Tage vor dem ersten Renntag in einem Hotel in Dschidda. Erst nach einer dreitägigen Quarantäne und einem negativen Corona-Test darf ich mich an Board des ehemaligen Frachtschiffs "St. Helena" begeben. Dieses Schiff ist das Hauptquartier der Extreme E, es transportiert sämtliche Fahrzeuge und über 63 Container mit Equipment zu den unterschiedlichen Rennen – und dient ganz nebenbei auch noch als Fahrerlager für die Teams. Nach dem Startschuss in Saudi-Arabien wird es zum Salzsee Lac Rose im Senegal aufbrechen, weitere Stationen sind die Arktis von Grönland, der Amazonas Brasiliens und die südlichen Gletscher Argentiniens. Diese Orte sind nicht willkürlich ausgewählt: Jede der fünf Veranstaltungen soll symbolisch auf ein spezifisches Umweltproblem hinweisen. „Meine Idee war es, den Motorsport zu nutzen, um zu zeigen, was in einigen der entlegensten und auch am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen unseres Planeten passiert“, sagt Organisator Alejandro Agag. „Hier in Saudi-Arabien geht es um die zunehmende Wüstenbildung, das nächste Rennen im Senegal behandelt die Plastikverschmutzung unserer Ozeane, in Grönland geht es um das Schmelzen der Polkappen, in Brasilien um die Zerstörung des Regenwaldes und in Argentinien um die Vernichtung der Permafrostböden und der Gletscher.“
An den nächsten zwei Tagen werden auf dem Schiff Vorträge von Wissenschaftlern über Klimawandel, Mikroplastik im Ozean oder das Aussterben der Meeresschildkröten gehalten. Zusammen mit den Teams und Sponsoren pflanzen wir Bäume in der Wüste oder säubern Strände von Plastikmüll. Agag will damit möglichst medienwirksam Aufmerksamkeit für die gute Sache generieren. Aber natürlich auch für seine neue Rennserie.




Nach drei Tagen Quarantäne und zwei Tagen auf dem Schiff ist es dann endlich so weit: Ich betrete zum ersten Mal das Renngelände. Gerade ist wie ein- gangs erwähnt Mattias Ekström vom Team Abt Cupra in die Boxengasse gefahren. Genau 45 Sekunden hat er jetzt Zeit für den Fahrerwechsel mit Teamkollegin Claudia Hürtgen. Denn bei der Extreme E soll neben dem Umweltaspekt auch die Gleichberechtigung vorangetrieben werden. Jedes Fahrerteam besteht daher aus einem Mann und einer Frau, nach der Hälfte der Strecke muss das Steuer an den jeweils anderen übergeben werden.
Wie extrem die Extreme E wirklich ist, stellt sich nur kurze Zeit später heraus: Ein paar Minuten nach dem Fahrerwechsel verliert Hürtgen bei einer Bergfahrt mit über 120 km/h die Kontrolle. Das Fahrzeug überschlägt sich fünfmal, bis es schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kommt. „Drei Minuten lang wussten wir nicht, ob sie noch lebt“, sagt Veranstalter Agag später, der Funk zum Fahrzeug war ausgefallen. Doch die Rettungssanitäter können Claudia Hürtgen aus dem Wagen befreien, glücklicherweise ohne größere Verletzungen. „Sobald du erst mal überschlägst, bist du nur noch Passagier in diesem Geschoss. Das geht dann alles sehr schnell“, erzählt mir eine ruhig und entspannt wirkende Claudia Hürtgen nur knapp eine halbe Stunde später. Das Team von Abt Cupra flucht, Agag dagegen freut sich. Er weiß, dass aufgrund der aufsehenerregenden Bilder des Unfalls die ganze Welt über sein Rennen berichten wird: „Das war ein spektakulärer erster Tag, besser hätte es gar nicht laufen können.“

Spektakulär, aber auch gefährlich. Die Bilanz noch vor Ende des ersten Renntags: drei kapitale Crashs plus diverse kleinere Zwischenfälle. Kein Wunder, bei Geschwindigkeiten von bis zu 170 km/h müssen die Fahrer auf der 8,8 Kilometer langen Runde zwischen Felsen, Canyons und Sanddünen stets den Kurs halten. Dabei gilt es, Höhenunterschiede von mehr als 400 Metern zu bewältigen, allein beim sogenannten Drop, einem der anspruchsvollsten Streckenabschnitte, geht es 100 Meter einen 45 Grad steilen Abhang nach unten. „Das fühlt sich wie beim Skifahren an, wenn man vor dem Abhang einer schwarzen Piste steht“, sagt der ehemalige Formel-1-Weltmeister Jenson Button, der nicht nur als Teamchef, sondern auch als Fahrer an der Extreme E teilnimmt. Neben ihm sind noch zwei weitere Formel-1-Weltmeister in die Extreme E eingestiegen: Nico Rosberg und Lewis Hamilton. Jedoch nur als Teamchefs, nicht als Fahrer.
„Ich bin froh, dass ich nicht hinter dem Steuer sitzen muss. Das wäre mir auch zu riskant, schließlich bin ich kein professioneller Rallye-Fahrer“, sagt Rosberg. „Um hier bestehen zu können, muss man mit allen Wassern gewaschen und hart im Nehmen sein.“





Anscheinend sieht das auch die Rennleitung so und reduziert ab der zweiten Qualifying-Runde die Leistung der Fahrzeuge für das restliche Rennen von 544 PS auf 306 PS. Insofern kommt es am zweiten Renntag, obwohl jetzt im K.-o.-System immer bis zu drei Wagen gleichzeitig auf der Strecke gegeneinander antreten, zu deutlich weniger Zwischenfällen. Aufgrund der Sichtverhältnisse gewinnt fast immer das Fahrzeug, das sich in den ersten 30 Sekunden an die Spitze setzen kann. Die riesige Staubwolke dahinter verhindert gewagte Überholmanöver. Im Finale kommt es zum Duell Rosberg vs. Hamilton – wie zuletzt 2016 in der Formel 1. Und wie damals kann sich auch heute das Team Rosberg durchsetzen. Nur die Champagner-Dusche für die Sieger muss ausfallen. Alkohol, in welcher Form auch immer, ist in Saudi-Arabien streng verboten.
Am Ende bleibt festzuhalten: Die Extreme E zieht Motorsport-Freunde wie mich dank ihrer atemberaubenden „Mad Max“-Wüstenkulisse definitiv in ihren Bann. Ganz abgesehen davon, dass man endlich einmal in einer Rennsportserie genauso viele männliche wie weibliche Fahrtalente zu sehen bekommt. Zugegeben, der Umweltaspekt der Extreme-E-Rennserie klingt verdächtig nach Greenwashing. Aber immerhin redet man nicht nur davon, grün zu sein, man setzt es auch oft konkret um. So werden die Batterien der Fahrzeuge mittels Brennstoffzelle und Wasserstoff geladen. Und der Einsatz des ehemaligen Frachtschiffs „St. Helena“ ist deutlich nachhaltiger als ein Transport per Flugzeug. Ob man jedoch eine Rennserie ausgerechnet in einem Staat wie Saudi-Arabien starten muss, der laut Amnesty International nicht unbedingt für die Achtung der Menschenrechte bekannt ist und dessen Haupteinnahmequelle aus dem Verkauf von fossilen Brennstoffen stammt, ist natürlich eine andere Frage. Ich jedenfalls freue mich auf das nächste Rennen, das am 29. und 30. Mai im Senegal stattfindet. Auch wenn ich es dieses Mal im Fernsehen und nicht live vor Ort ansehen werde.


Alle Artikel