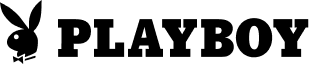Warum ist die Frauen-EM für jeden Fußball-Fan ein Muss, Frau Schult?


Almuth Schult weiß, wie es sich anfühlt, einen großen Titel zu feiern: 2013 wurde sie mit der Nationalmannschaft Europameisterin, 2016 folgte olympisches Gold. Insgesamt stand sie 66 Mal für Deutschland im Tor. Im Frühjahr 2024 beendete sie ihre aktive Laufbahn. Heute ist sie als ARD-Expertin, Podcasterin („Almuths Pausen-T“) und Kolumnistin beim RedaktionsNetzwerk Deutschland tätig. Wir sprachen mit ihr über die Faszination großer Turniere und warum sie überzeugt ist, dass man sich dieses Fußballfest keinesfalls entgehen lassen sollte
Ex-Nationaltorhüterin Almuth Schult über die Frauen-EM 2025, die Titelfavoriten und die Chancen der DFB-Frauen
Frau Schult, warum sollte man sich die Frauen-EM 2025 in der Schweiz auf keinen Fall entgehen lassen?
Aus den gleichen Gründen, aus denen man sich kein großes Turnier entgehen lassen sollte: Es sind Weltklasse-Spielerinnen dabei, junge Talente werden überraschen und es wird Neuentdeckungen geben. So ein Turnier erzählt immer auch Einzelgeschichten und während im Männerfußball viele Geschichten schon auserzählt sind, gibt es bei den Frauen noch Raum dafür. Am Ende ist es ganz einfach: Fußball begeistert.
Die EM in England vor vier Jahren hat, was die Zuschauerzahlen betrifft, alle Rekorde gebrochen. Das Endspiel in Wembley sahen 87.192 Zuschauer im Stadion, im TV waren es knapp 22 Millionen. Kann die Schweiz in dieser Hinsicht überhaupt noch einen draufsetzen?
Erstmal muss man berücksichtigen, dass die Rahmenbedingungen in diesem Jahr andere sind. Die Spielorte in der Schweiz bieten nicht die Kapazität eines Wembley-Stadions mit seinen über 80.000 Plätzen. Das größte Stadion, der St. Jakob-Park in Basel, fasst rund 38.000 Zuschauer. Die Schweiz ist keine Fußballnation in der Größenordnung von England, Deutschland oder Spanien. Trotzdem bin ich überzeugt, dass dieses Turnier in der Schweiz ein Erfolg wird.
Warum?
Die Stadien sind jetzt schon fast ausverkauft und die Infrastruktur ist für die Fans hervorragend – kurze Wege, eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung und ein gut ausgebauter Nahverkehr machen es den Zuschauern einfach, sich fortzubewegen. Auch im TV werden sicher viele Fans das Turnier verfolgen.
Wie schätzen Sie die Chancen der deutschen Mannschaft ein?
Die deutsche Mannschaft war in den letzten Monaten ein bisschen wie ihre männlichen Kollegen – ein Team mit Höhen und Tiefen. Es gab sowohl überzeugende Halbzeiten als auch weniger gelungene Phasen. Theoretisch hat die Mannschaft das Potenzial, ganz oben mitzuspielen und die entscheidenden Spiele zu gewinnen. Allerdings haben sie auch schon gezeigt, dass sie selbst gegen vermeintlich schwächere Gegner wie Polen, Wales oder Schottland Probleme bekommen können. Ich bin gespannt, wie sich das Team unter dem neuen Bundestrainer Christian Wück präsentieren wird.
Welche Nationen zählen aus Ihrer Sicht zu den Favoriten?
Neben den üblichen Verdächtigen wie Spanien und England ist auch die Niederlande stark einzuschätzen. Schweden hat sich zuletzt gut präsentiert und steht aktuell auf Platz sechs der FIFA-Weltrangliste. Norwegen hat starke Einzelspielerinnen, die in internationalen Ligen aktiv sind – auch wenn sie ihr Potenzial zuletzt nicht immer auf den Platz gebracht haben. Frankreich ist ebenfalls eine Top-Mannschaft, hat aber in den vergangenen Jahren immer wieder in der K.o.-Phase enttäuscht.
Hängt die Stärke dieser Nationalteams mit dem Niveau ihrer nationalen Ligen zusammen?
Ja und nein. In England ist es auf jeden Fall so: Die Liga ist für mich die beste in Europa. In Spanien gibt es einige Spitzenklubs wie Barcelona, aber darunter fällt das Niveau ab – dort sehen wir im Vergleich häufiger hohe Siege mit vier oder mehr Toren Unterschied. In Deutschland ist es ausgeglichener. Zwar hat kein Verein das Standing oder Budget von Barcelona, aber die Leistungsdichte ist höher. Selbst Klubs wie Leverkusen haben zuletzt um die Champions-League-Plätze mitgespielt. Frankreich hat mit Lyon und PSG zwei dominierende Vereine, die Mannschaften dahinter haben wenig Chance. In Schweden und Norwegen dagegen ist das Liganiveau heute nicht mehr so hoch wie früher. Dort spielen viele der Topspielerinnen inzwischen im Ausland.
“Die meisten Spielerinnen in den Ligen leben wie alle anderen auch – das erdet und zeigt sich auch auf dem Platz
Ist der Frauenfußball für Sie in gewisser Weise ein Gegenentwurf zum Männerfußball?
So kann man das glaube ich nicht ausdrücken, aber es gibt einen großen Unterschied in der Kommerzialisierung. Die Nettospielzeit ist im Frauenfußball oft höher, es wird weniger reklamiert und häufiger einfach weitergespielt. Ein Beispiel: Bei der WM 2019 wurde erstmals der VAR eingesetzt mit männlichen Videoschiedsrichtern. Die Spiele wurden im Nachhinein analysiert und es gab Szenen, in denen gar nicht eingegriffen wurde, obwohl es klare Elfmeter waren – einfach, weil die Spielerinnen weitergespielt haben. Die Männer haben es nicht überprüft, weil niemand reklamiert hat.
Gibt es im Frauenfußball also weniger Star-Allüren?
Ich denke schon. Das liegt an der Mentalität, die durch andere Umstände entsteht. Viele Spielerinnen verdienen kein volles Gehalt, haben keinen Athletiktrainer, keinen Koch, keinen Berater. Sie organisieren ihren Alltag selbst – Wohnungswechsel, Ausbildung, Arbeitsplatz und auch mal die Vertragsverhandlungen. Nur wenige verdienen richtig gut oder haben Millionen Follower. Die meisten Spielerinnen in den Ligen leben wie alle anderen auch – das erdet und zeigt sich auch auf dem Platz.
Wo sehen Sie die größten Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball?
Der Männerfußball ist natürlich schneller, das ist physiologisch bedingt. Männer haben einfach andere körperliche Voraussetzungen – wie in fast allen Sportarten, wo getrennt nach Geschlecht angetreten wird. Technisch und taktisch holen die Frauen aber auf. Der große Unterschied liegt in der Ausbildung. Ich persönlich habe mit 15 erst gelernt, mit dem schwächeren Fuß zu schießen – da war es das erste Mal Thema bei einem Trainer. Im Männerbereich geschieht das spätestens mit zehn, zwölf Jahren. Diese Trainingsjahre fehlen vielen Spielerinnen.
Und das hat Einfluss auf das Leistungsniveau.
Ja, aber das wird sich mit der weiteren Professionalisierung verändern.
Könnte die EM auch in dieser Hinsicht weiterhelfen?
Diesen Effekt erhofft man sich immer von großen Turnieren. Das war bei uns ähnlich – ob bei der Herren-WM 2006 oder bei der Frauen-WM 2011. Solche Ereignisse bringen Nachwuchs, sorgen für Aufmerksamkeit, Sponsoren und TV-Gelder. Sie sind eine große Chance für den ganzen Sport.